Spiritualität und Psychotherapie im Dialog (Teil 2)
Laut dem Autor, Psychotherapeuten und langjährigen spirituellen Praktiker Dr. Sylvester Walch ergänzen sich Spiritualität und Psychotherapie auf hervorragende Weise auf dem Weg zu Heilung und Ganzheit. Was dabei beachtet werden sollte und wieso eine spirituelle Praxis eine Psychotherapie nicht überflüssig macht, erfährst du im folgenden Beitrag.
Seelische Integration und Psychodynamik
Da sich viele Menschen gerade aus inneren Nöten heraus spirituellen Richtungen anvertrauen, soll an dieser Stelle eines ganz klar zum Ausdruck gebracht werden. Eine spirituelle Praxis macht Psychotherapie nicht überflüssig.
Trotz der Hochkonjunktur esoterischer, schamanischer und spiritueller Angebote landet man allmählich wieder auf dem harten Boden der Realität, nachdem überzogene Heilserwartungen enttäuscht worden sind. Man muss leider feststellen, dass die dauerhafte Veränderung von chronifizierten behindernden Lebensmustern nur sehr schwer gelingt. Es ist auch klargeworden, dass umfassende Bewusstseinsexperimente und langjährige Meditationspraxis alleine keine psychischen Probleme lösen können. Freimütig bestätigt das Ram Dass (1989), wenn er einräumt, dass er in der gesamten Zeit seines spirituellen Weges nicht eine einzige seiner Neurosen losgeworden sei. Es ist der Gefahr entgegenzutreten, dass sich hinter einer spirituellen Fassade eine einsame, an sich selbst leidende, Persönlichkeit verbirgt, die sich überdies dafür schämt und verachtet. Aus diesem Grunde bleibt die psychodynamische Perspektive immer aktuell und ist nicht mit dem Eintreten in eine spirituelle Praxis erledigt.
Psychische Probleme können, falls sie unbearbeitet bleiben, sogar spirituelle Prozesse nachhaltig behindern. Zum Beispiel berichtete ein Klient, der seit Jahren in einem Ashram lebt und sich regelmäßig den Übungen unterzieht, eines nachts von Selbstbefriedigung geträumt zu haben. Anschließend litt er unter Verfolgungs- und Bestrafungsfantasien, sobald er sexuelle Gelüste bekam. Das spirituelle Gebot, ein gutes Leben zu führen, wurde durch ein bestrafendes Über-Ich ersetzt. Anerkennung von spiritueller Autorität hat aber nichts mit Unterwerfung und Strafe zu tun. Gesunde Spiritualität ist auch eng mit der Bewusstmachung von Schattenaspekten verknüpft.
Die mangelnde Integration des je eigenen Schattens kann folgende Auswirkungen haben: Rigidität, unbarmherzige Strenge, subtile Aggressivität, Fassadenhaftigkeit, Falschheit, Härte gegen sich und andere. Selbstdestruktive Askese, Kasteiung oder Selbstverletzungen, wie sie zum Beispiel in ekstatischen Selbstgeißelungsritualen vorkommen, sind extreme Formen eines Krieges gegen die Natur.
Ein offener Umgang mit Konflikten, Aggressionen und Sexualität ist unumgänglich, denn sonst entstehen Tabus, verdeckte Normen, ein Hang zur Harmonisierung von Widersprüchen und ein rigider Umgang mit Zweifeln. Das Eingeständnis von Zweifeln ist indes kein Zeichen von Schwäche, sondern eine Folge ehrlichen Interesses um innere Wahrhaftigkeit und für den spirituellen Weg außerordentlich wichtig. Wer das nicht beachtet, gerät in die Sackgasse der Abhängigkeit. Einer reifen Persönlichkeit, die in der Lage ist, autonom zu handeln und Verantwortung für sich zu übernehmen, gelingt es besser, spirituelle Erfahrungen zu integrieren und nicht abzuheben.

Psychotherapie ist eine Hilfe auf Zeit, um seelische Bruchstellen zu heilen, psychische Blockierungen zu überwinden, zur Liebe zu befähigen und Lebensfreude zu empfinden. Spiritualität hingegen ist ein lebenslanger Entwicklungsweg, um dem Geheimnis des Lebens auf die Spur zu kommen und bedingungslose Liebe im Alltag zu verwirklichen.
Gerade am Beispiel der Liebe lassen sich auch die je verschiedenen Wirkungsbereiche von Psychotherapie und spiritueller Praxis differenzieren. Während Psychotherapie sozusagen auf den Nahbereich der personalen Liebe gerichtet ist, sollen die spirituellen Übungen dazu befähigen, diesen auf die transpersonale Erfahrungsdimension hin zu erweitern. Liebe als spirituell-transpersonale Erfahrung bewirkt damit eine Ausdehnung der Liebesfähigkeit. Im Alltag erleben wir dies zum Beispiel als Mitgefühl zu fremden Menschen vor allem dann, wenn uns tragische Einzelschicksale berühren oder wenn wir unter dem Eindruck von Katastrophen stehen. Wir öffnen unser Herz und sind bereit, zu helfen, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Die segensreiche Wirkung des Mitgefühls strahlt dann auf uns selbst zurück, da wir im Nächsten auch jenen spirituellen Grund würdigen, aus dem heraus wir selber existieren.
In der Metta Sutra (Reuter, 2007, p. 17), einem zentralen Text des Theravada-Buddhismus, verheißt dieses voraussetzungslose Mitgefühl das »Weilen im Heiligen« und verbindet es mit der Erfahrung frühkindlicher Geborgenheit: »Wie eine Mutter mit ihrem Leben ihr einzig Kind beschützt und behütet, so möge man für alle Wesen und die ganze Welt ein unbegrenzt gütiges Gemüt entwickeln, ohne Hass, ohne Feindschaft, ohne Begrenzung.«
Niemand kann eine angemessene Beziehung zu seinem spirituellen Wesensgrund entwickeln, wenn darin nicht auch das Verhältnis zum Mitmenschen miteinbezogen ist.
Erich Fromm (1977, p. 70) hat diesen umfassenden Anspruch von Liebesfähigkeit vor dem Hintergrund der schrecklichen historischen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts formuliert: »Nächstenliebe ist Liebe zu allen menschlichen Wesen; charakteristisch für sie ist das Fehlen der Ausschließlichkeit. Wenn ich die Fähigkeit des Liebens entwickelt habe, kann ich nicht umhin, meinen Nächsten zu lieben. In der Nächstenliebe liegt das Erlebnis der Vereinigung mit allen Menschen, das Erlebnis der menschlichen Solidarität und der menschlichen Einheit«.
Zwischen Ich und Du wird die Wesenseinheit zur erfahrbaren Wirklichkeit. »Tat tvam asi« bezeichnet in den Upanischaden (Thieme, 1985) die höchste Stufe der menschlichen Erkenntnis: Dieses da bist du. Es ist die Einsicht in die Wesensidentität, durch die wir alle miteinander verbunden und vernetzt sind auf die Weise, dass nichts mehr für sich allein Bestand haben kann. Liebe in dieser umfassenden Sichtweise zielt auf die Vereinigung von Individualität und Universalität. Darin eben besteht ihre spirituelle Qualität, dass sie sich nicht ausschließend, sondern jeden Menschen, jedes Lebewesen, ja den Kosmos im Ganzen einbeziehend versteht.
Eine weitere Gefahr besteht darin, Spiritualität als Ersatztherapie anzusehen. Eine brüchige Persönlichkeit mit einem schwachen Ich wird darin in der Regel zuallererst Er-Lösung von außen suchen wie ein Süchtiger in einem Suchtmittel. Deshalb werden erfahrene spirituelle Lehrer einem Schüler mit emotionalen Störungen zwischenzeitlich eine Psychotherapie empfehlen, denn nur in einer authentischen Persönlichkeit kann sich eine authentische und lebensfördernde Spiritualität entfalten. Authentizität setzt Wahrhaftigkeit im Verhältnis zu sich selbst voraus. Wird das pathologische Material hinreichend bearbeitet, kann eine spirituelle Praxis zur Auflösung von alten Mustern und verfestigten Gewohnheiten hilfreich sein. Kommunikative Kompetenzen kommen besser zur Geltung, wenn die Strukturen der Persönlichkeit, aus denen unser Handeln entspringt, einerseits stabil und andererseits flexibel sind (Rudolf, 2006). Das ist aber nur dann möglich, wenn seelische Wunden geheilt, unbewusste Konflikte geklärt und die abgespaltenen Anteile der Seele wieder integriert werden. Dadurch entwickelt sich auch ein verfeinerter Spürsinn, der auf verkörperter Selbstwahrnehmung beruht (Fogel, 2013). Darauf aufbauend können sich Authentizität, Lebendigkeit und Empathie besser entwickeln.
Durch regelmäßige Einübung der Entidentifikation und Achtsamkeit, worauf in den spirituellen Wegen Wert gelegt wird, können gerade hartnäckige Fixierungen leichter durchbrochen und die bisherige Opferrolle kraftvoller überwunden werden. Da in der Meditationspraxis das nach Inhalten greifende Bewusstsein etwas zurücktritt und man sich auf den gegenwärtigen Augenblick fokussiert, treten etwaige Sorgen, Pläne oder Frustrationen, mit denen wir uns sonst intensiv beschäftigen, in den Hintergrund. Damit etabliert sich in uns ein Ort der Stille, der frei von alltäglichen Konflikten, Bewertungen und Erwartungen ist. Daraus entwickelt sich mit der Zeit eine inspirierende und heilende Quelle der Kraft, die uns besser erspüren lässt, was uns guttut und was schädlich für uns ist.
Gar nicht hoch genug einzuschätzen ist auch das heilungsfördernde Potenzial spiritueller Erfahrungen. Sie erwecken die Liebe zum Leben, das menschliche Mitgefühl und die Erfahrung der Geborgenheit im Größeren. Das Bedürfnis nach tiefergehenden Erfahrungen tritt meistens dann ins Leben von Menschen, wenn sie merken, dass sie das, was sie haben und was sie sind, nicht wirklich glücklich und zufrieden macht.
Die transpersonale Perspektive in der Psychotherapie
Abraham Maslow (1973, 1994), dessen »Psychologie des Seins« einen entscheidenden Einfluss auf das Entstehen der transpersonalen Psychologie hatte, untersuchte Menschen, die er als selbstverwirklicht einstufte und die von sogenannten peak experiences, also Gipfelerlebnissen, berichteten. Dabei kam er zu der Auffassung, dass jedem Menschen ein Bedürfnis nach Selbstverwirklichung innewohnt. Dieses ist nicht auf das persönliche Glück bezogen, wie es häufig missverstanden wird, sondern zielt mehr in Richtung Gemeinwohl. Maslow fand bei selbstverwirklichten Menschen heraus, dass bei ihnen Werte wie Menschlichkeit, Lebendigkeit, Wahrhaftigkeit, Offenheit, Güte und Ganzheit von zentraler Bedeutung sind. Darüber hinaus berichteten sie von Zuständen spontan erweiterten Bewusstseins, Energie- und Lichtphänomenen sowie dem Erleben transzendenter Verbundenheit, ähnlich den von Mystikern beschriebenen Einheitserfahrungen. Ferner hat Stanislav Grof (1985; Grof & Bennett, 1993) durch seine Arbeiten entdeckt, dass das Bewusstsein unter bestimmten Bedingungen in der Lage ist: » […] die gewöhnlichen Grenzen des Körper-Ichs sowie die Beschränkungen von Raum und Zeit zu überschreiten«.
In der transpersonalen Psychologie sah Maslow die vierte Kraft der Psychologie, neben Behaviorismus, Tiefenpsychologie und humanistischer Psychologie. Sie untersucht Erfahrungen, in denen der alltägliche Wachbewusstseinszustand transzendiert wurde. Ihr Kernanliegen ist es, sich an verborgene Lebensprozesse und die großen Fragen des Seins wieder heranzutasten, denen die herkömmliche Psychologie gewöhnlich ausweicht, um nicht als unwissenschaftlich zu gelten: Woher kommen wir und wohin gehen wir? Existieren wir in irgendeiner Form weiter – über den Tod hinaus? Welchen Sinn haben Krisen, schwere Krankheiten oder Katastrophen? Wozu leben wir und was macht das Leben lebenswert? In ihren Antworten stützt sich die transpersonale Psychologie dabei sowohl auf alte Weisheitslehren als auch auf moderne Bewusstseinsforschung.

Ihr Verdienst ist es ebenso, den Dialog zwischen Psychotherapie und Spiritualität in Gang gebracht zu haben, um Menschen mit »spirituellen Krisen« und außergewöhnlichen Seinserfahrungen angemessen begleiten zu können. Für die transpersonale Psychologie ist der Mensch mehr als nur Persönlichkeit, Lebensgeschichte oder ein Ensemble von Rollen. Sie sieht ihn getragen von etwas Größerem und durchdrungen von dem grenzenlosen Einen.
Auch in vielen anderen Denkströmungen wie dem Taoismus, Tantrismus oder der universellen Mystik wird die singuläre, gänzlich untrennbare Totalität des All-Einen in allen Erscheinungen thematisiert (Quekelberghe van, 2005). Diese universale Dimension des Seins kann jedoch nur durch persönliche Erfahrung berührt werden. Wer erkennen will, wer er wirklich ist, muss die Tür nach innen aufstoßen. Für viele Mystiker ist der Weg nach innen der längste Weg, den es zu gehen gilt. Es ist ein steiniger Weg, der uns einiges abverlangt, denn es gilt zunächst, die vererbten und sozialisierten Fühl-Denkschemata (Ciompi, 1999) aufzubrechen, um das Umgreifende und das Dahinterliegende zu erspüren. Dabei können uns Techniken unterstützen, die erweiterte und veränderte Bewusstseinszustände hervorrufen. Das holotrope Atmen, von Stanislav Grof (1987) begründet, führt uns durch den Schirm des Alltagsbewusstseins hindurch, um Einblicke in tiefere Schichten der Existenz zu gewinnen und für die Wirksamkeit der inneren Weisheit empfänglicher zu sein.
In den letzten 25 Jahren durfte ich viele Menschen mit Hilfe dieser Methode, in der beschleunigtes Atmen, erlebnisfördernde Musik und prozessorientierte Körperarbeit im Mittelpunkt stehen, begleiten. In »Dimensionen der menschlichen Seele« (Walch, 2009) habe ich das Konzept, die praktische Durchführung und Erfahrungsdimensionen dieses Praxisweges der transpersonalen Psychologie dargelegt, der sich für die Integration von psychodynamischen und spirituellen Prozessen besonders eignet. Da transpersonale Bewusstseinsarbeit bis in die Tiefenstrukturen des Seins und in die implizite Ordnung der Natur (Bohm, 1985) vorzudringen vermag, hat sie eine enorme Reichweite und Integrationskraft, die über die gewöhnlichen Grenzen des empirischen Bewusstseins hinausgeht. Dabei werden individuelle wie kollektive Heilungs- und Wachstumsprozesse in Gang gesetzt. Sie öffnen unser Herz für bedingungslose Liebe, befreien unseren Geist von Vorurteilen und fördern achtsame Umgangsweisen. So können sich Mitmenschlichkeit, Solidarität und Gemeinsinn in der Welt ausweiten. Gleichzeitig muss man aber auch feststellen, dass der Weg ganzheitlicher Bewusstwerdung, der sich entlang von Differenzierungs- und Integrationsprozessen entfaltet, nie abgeschlossen sein kann. Deshalb haben wir immer wieder aufs Neue zu überprüfen, wo wir in unserer Entwicklung stehen, welche alten Muster uns behindern, welche Schattenaspekte uns beeinflussen und ob der Kontakt zum größeren Ganzen intakt ist.
Dieser lebenslange Prozess der Selbstverwirklichung kann nämlich immer wieder durch aufkommende Ängste und Widerstände gehemmt werden, wenn wir unter dem Einfluss unverarbeiteter Probleme stehen. Sie repräsentieren unbewusste Reste früherer Traumen, chronischer Konflikte sowie Defizite von Geborgenheit und Wärme (Petzold, 1993). Das daraus entspringende Misstrauen dem Leben gegenüber kann rasch zu Verengungen, Energieverlust und kompensatorischen Kontrollmechanismen führen. Der darunter leidende Mensch fühlt sich dann nicht mehr mit sich, dem Leben und seiner Umwelt verbunden. Um diese immer wieder einsetzende Stagnation tiefgreifend zu bearbeiten, braucht es eine Methode wie das holotrope Atmen, die nicht nur eine spirituelle Öffnung bewirkt, sondern auch die dissoziierten Bewusstseinsinhalte bewusstmacht sowie die dazugehörigen emotionalen Reaktionen und körperlichen Impulse mobilisiert.
Das Spektrum der Erfahrungen kann lebensgeschichtliche Themen, perinatale Zustände, Erlebnisse, die über die gewöhnlichen Raum- und Zeitgrenzen hinausgehen sowie spirituelle Erfahrungen umfassen, je nachdem was für den nächsten Entwicklungsschritt von Bedeutung ist. Wir erfahren uns unter Umständen sogar nicht mehr als individuiert, sondern vielmehr als durchlässig und transparent, verbunden mit Allem, was uns umgibt. Da im holotropen Atmen transzendente Erlebnisse stets mit seelischen Integrationsprozessen korrespondieren, wird von vorneherein der Gefahr einer verdrängenden Idealisierung entgegengewirkt.
Im spirituellen Erwachen wird der Suchende gefunden, denn er ist für das offenbarende Erlebnis bereit. Der Erfahrende fühlt sich von etwas Größerem getragen und mit allem verbunden. Es kommt zu Lichterscheinungen, Energiephänomenen, spontanen Zuständen des Glücks, der Hingabe und der Demut. Davon tief bewegt, ist man gleichzeitig gelassen und ruht in der inneren Mitte. Um diese Erfahrungsdimensionen im Laufe der Zeit besser in unser Leben integrieren zu können, müssen die inneren Strukturen geweitet und umgebaut werden. Infolgedessen können auch die frei werdenden Kräfte getragen werden. Durch die regelmäßige spirituelle Übungspraxis lernt der Suchende, seine öffnenden Erfahrungen in konkretes Handeln umzusetzen. Dabei müssen auch Widerstände beseitigt werden, die im Wesentlichen durch unser Ego aufgebaut wurden. Das lehren uns nahezu alle spirituellen Schulen.
Egotransformation und Ichstärkung
Da ich in meinen Veröffentlichungen detailliert Phänomenologie und Struktur des Egos, insbesondere in seinen Unterschieden und Ähnlichkeiten zum psychologischen Ichbegriff (vgl. Walch, 2013) herausgearbeitet habe, werde ich hier aus Zeitgründen nur einige Aspekte grob zusammenfassen.
Umgangssprachlich würden wir einem Menschen ein starkes Ich zuschreiben, wenn er weiß, was er will, sich seine Meinung sagen traut und tatkräftig für seine Ziele eintritt. Auch Toleranz und Dialogfähigkeit sind Ausdruck eines eigenständigen Ichs. Das starke Ich wird jedoch zum Ego, wenn es seine Ziele gegen die berechtigten Ansprüche anderer durchsetzt, die Grenzen nicht respektiert, kontrolliert und manipuliert, um für sich selber das Beste herauszuholen. Es sind also vor allem jene Gedanken, Gefühle und Handlungen, die in Beziehungen eine unangenehme Atmosphäre hervorrufen und durch die wir anderen, aber auch uns selbst schaden.

Auf die Spur unserer Egoverstrickung gelangen wir schon durch wenige und sehr einfache Fragen, wie zum Beispiel: Löst der Erfolg eines anderen in mir Neid aus oder erhöhen schlechte Nachrichten über andere mein Selbstwertgefühl? Manipuliere und kontrolliere ich Beziehungen, um Bestätigung zu erlangen? Reagiere ich gekränkt oder beleidigt, wenn mich jemand sachlich kritisiert? Lehne ich andere ab, wenn sie nicht so sind, wie ich sie gerne hätte?
In Situationen, in denen wir vom Ego dominiert werden, erleben wir uns als verbissen, gierig, eifersüchtig, unversöhnlich, hart und abwertend. Wir hören nicht zu, halten gerne an unseren Vorurteilen fest, beziehen unsere Sicherheit eher aus materiellen Werten und äußerem Ansehen. Da das Ego Gefühle von Angst und Unsicherheit kompensiert, können diese auch in Form von Minderwertigkeitskomplexen aktualisiert werden.
Das Ego deckt in der Regel die innere Empfindsamkeit zu und lässt den natürlichen Strom der Gefühle versiegen. Die Folgen sind soziale Kälte, mangelnde Mitmenschlichkeit und fragmentierte Beziehungswelten, in denen keine verlässlichen und langfristigen Bindungen entstehen können. Das Ego bindet unsere kreativen Kräfte und macht uns undurchlässiger für Intuitionen. Vor allem aber zeigt sich das Ego im tiefen Misstrauen gegen alles, was einfach passiert. Das hat zur Folge, dass wir uns einer kreativen Auseinandersetzung mit Lebensumständen, die uns voranbringen könnten, verweigern.
So sind wir denn einer weiteren wichtigen Begleiterscheinung des Egos ausgeliefert, nämlich dem Gefühl der Getrenntheit. Mit Hilfe des Ichs lernt man zunächst, notwendigerweise, sich als Person von anderen zu unterscheiden. Erst über die Fähigkeit zur Separation kann sich nämlich Individualität und das, was wir Persönlichkeit nennen, ausbilden. Dadurch werden unsere Talente, Fähigkeiten und Kompetenzen in die Welt gebracht. Gelingt das nicht, ziehen wir uns von der Welt zurück. Depressive Verstimmungen weisen häufig auf ein nicht ins Sein gebrachte Leben hin. Sehe ich jedoch das »Ich bin, ich kann, ich habe« als einzige Wirklichkeit meines Lebens, so werden sich um dieses Ich zwangsläufig Egoschalen bilden. Die Überbetonung der Ich-Persönlichkeit führt zum Gefühl der Ausschließlichkeit des Existierens in Bezug auf die eigene Person.
Daher rühren auch die Abneigung gegen alles, was dieses Ich gefährden könnte, und ebenso das Hingezogensein zu allem, was dieses Ich erfreut oder beruhigt. Das Fragwürdigwerden dieses Persönlichkeits-Ichs, etwa in der Krise der Lebensmitte, ist oft Ausgangspunkt des spirituellen Suchens. Folgende Fragen werden dann meistens radikal gestellt: Wer bin ich wirklich? Wie lebe ich? Genügt es, sich sicher zu fühlen und von anderen anerkannt zu werden? Wir ahnen, dass das, was wir gewöhnlich wahrnehmen, nicht alles sein kann, und erkennen, dass wir dann, wenn wir so denken, falsche Vorstellungen vom Leben haben. Das ist, was spirituelle Richtungen des Ostens als Maya, als Illusion bezeichnen. Maya bedeutet also, dass unsere Vorstellung von uns selbst und der Welt für absolut genommen werden. Der spirituelle Weg hilft uns, durch die Relativierung des Bestehenden, starre Identifizierungen zu lockern.
Wir kennen durchaus ähnliches in der Psychotherapie. Wenn jemand aufgrund ständig abwertender Elternbotschaften felsenfest davon überzeugt ist, dumm zu sein, so helfen wir ihm, die Brille seiner negativen Selbstbewertungen abzusetzen und sich seiner eigentlichen Fähigkeiten bewusst zu werden. Dort, wo der Egoismus krankhafte Züge trägt, wenn wir an die unterschiedlichen Formen des Narzissmus denken, sollten wir allerdings nicht von Ego in spiritueller Hinsicht sprechen, sondern von einer schweren Persönlichkeitsstörung ausgehen.
Wenn wir bereit sind, am Ego zu arbeiten, beginnt ein Prozess des Loslassens und Entdeckens. Die inneren Schwingungen werden subtiler erfahren, Fassaden beginnen sich aufzulösen. Das Leben selbst wird lebendiger und wahrhaftiger. Aus den transformierten Egoanteilen entstehen neue Ich-Qualitäten. Das Ich wird dann zum Sinnesorgan des Selbst, kann flexibel reagieren und ist fähig, kontraproduktive Konzepte wieder loszulassen. Dadurch fällt es uns leichter, schwierigen Situationen gegenüber offener zu sein und eigene Vorstellungen und Konzepte zu relativieren.
Der Abbau des Egos bewirkt also immer eine Öffnung zum wirklichen Sein und das Zurückkommen in den Fluss des Lebens. Ähnlich der Arbeit an Widerständen in der Psychotherapie ist aber zu berücksichtigen, dass das Ego nur dann transformiert werden kann, wenn man in diesem Prozess mit sich mitfühlend und wertschätzend umgeht. Wenngleich die Auflösung des Egos nicht einfach gelingt, erfährt unsere Auffassung vom Sinn des Lebens durch diese Bemühung eine entscheidende Veränderung. Das eigennützige Wollen weicht einer dienenden und damit im Wortsinn demütigen Haltung gegenüber dem Lebensganzen. Stillschweigend verwandeln sich dann auch die Zielvorstellungen, die wir mit den daraus entstehenden Aufgaben verbinden. Das Handeln wird nicht mehr von bestimmten Erwartungen und Anerkennungswünschen bestimmt, sondern von der Freude, dem universellen Heilswillen der inneren Weisheit zum Ausdruck verhelfen zu können. Wenn wir auf dieser Weise durch unser Leben dem Ganzen dienen, werden wir auch der Welt achtsamer, mitfühlender und liebevoller begegnen.
Eine von Achtsamkeit und Mitgefühl geprägte Lebenseinstellung ist gerade in der heutigen Zeit wichtiger denn je. In einer historischen Situation, die von einer eigenartigen Ambivalenz geprägt ist: Auf der einen Seite Desorientierung, Gewaltzunahme, religiöser Fanatismus und Beziehungslosigkeit, und auf der anderen Seite Sehnsucht nach Solidarität, Liebe und spiritueller Erfahrung. Die Kluft scheint sich in einer immer beschleunigteren Lebenswelt noch weiter zu vertiefen.
Mystik des Lebens
Wenn wir Liebe und Mitgefühl in einer umfassenden Qualität aktualisieren, existieren wir nicht mehr aus uns allein heraus, sondern wesentlich aus unserer Verbundenheit mit dem Seinsganzen. Dadurch erleben wir uns im Innersten verankert, können besser über unsere Potenziale verfügen und in schwierigen Situationen gelassener reagieren. Gleichzeitig werden wir offener für wegleitende Hinweise, denn wir beginnen dem, was im Leben geschieht, immer mehr zu vertrauen. Ich brauche dann nicht mehr abzuwehren oder kontrollierend einzugreifen, sondern kann mich mutig dem Leben stellen und zwanglos lebendig werden lassen, was sich verkörpern möchte. Anregungen und Impulse können angstfreier aufgegriffen und wieder losgelassen werden.
Dabei wird uns klar, dass wir sogar an widrigen Umständen wachsen und reifen können, weil auch sie aus der Totalität des All-Einen hervorgehen. Das ist das Geheimnis des Lebens und die Quintessenz jeder Mystik. Wenn die gewohnten Abläufe gestört werden oder eine höhere Gewalt eingreift, ist es für einen Suchenden sehr hilfreich, den aufkommenden Hader loszulassen, innezuhalten und sich von der Situation führen zu lassen. Gerade in Bedrängnis sind wir für Gnadenerfahrungen prädestiniert. Das Leben kreiert immer wieder Situationen, in denen wir wachsen können, auch wenn sie noch so überflüssig scheinen.
Jean Gebser vertritt die Einsicht: »[…] dass alles, was uns geschieht, gestaltend und kräftigend zu unserem Leben, nämlich zu uns selber gehört und dass es somit durchaus abwegig ist, sich über Missgeschick und dergleichen zu beklagen […]« (Müller, 1999, p. 54). Auch Krisen können, wie wir wissen, Entwicklungsschübe auslösen und schlagartig klarmachen, was zu tun ist. Dabei werden oft vertraute Bezüge aufgebrochen und Prioritäten neu geordnet. Jede Situation wird so zum helfenden Freund, jedes Hindernis zum ermutigenden Lehrer.
Natürlich ist es nicht von vorneherein entschieden, ob wir solche Fingerzeige auch aufnehmen. Sie überhaupt erst wahrzunehmen und als solche zu deuten, erfordert unser eigenes Zutun. Es sind ungewohnte Wege, die sich eröffnen, wenn wir uns auf diese Einsichten einlassen. Wir dürfen aber darauf vertrauen, dass sich mit der Bereitschaft zur inneren Verwandlung auch die äußeren Lebensumstände zum Besseren ändern werden. Wenn wir diese Einstellung, die mit dem Satz »Alles kann sich zum Besten wandeln« ausgedrückt werden kann, inmitten des Alltags verwirklichen, werden Furchtlosigkeit, Gelassenheit und tiefer Frieden eine neue atmosphärische Qualität in unser Leben bringen.
Das Leben mit seinen Krisen und Übergängen wird dann zu einem täglichen Abenteuer, getragen von einem universalen, zeitlosen und beständigen Wesensgrund, von dem her sich Polaritäten und Bewertungen in ein sinnvolles Ganzes einordnen. Psychotherapie, Arbeit mit veränderten Bewusstseinszuständen und spirituelle Übungspraxis können sich auf dem Weg zum Wesentlichen und zur Ganzheit in wunderbarer Weise ergänzen.

Zum Autor
Sylvester Walch, Dr. phil., geb. 1950, ist Ausbilder für Psychotherapie. Seit mehr als 25 Jahren verbindet er in seiner Arbeit Psychotherapie und Spiritualität. Er ist Gesamtleiter der Curricula für Transpersonale Psychologie, Holotropes Atmen und körperorientierte Verfahren. Er leitete über viele Jahre eine stationäre psychotherapeutische Einrichtung und hat Lehraufträge an verschiedenen Universitäten. Er verfasste zahlreiche Artikel und mehrere Bücher. Sylvester Walch verfügt über eine langjährige Meditationspraxis und entwickelte einen ganzheitlichen Weg, in dem seelische Heilung und geistige Praxis integriert werden.
Literatur
Bohm, D. (1985). Die implizite Ordnung. München. Dianus-Trikont.
Ciompi, L. (1999). Die emotionalen Grundlagen des Denkens. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Dass, R. (1989). Verheißungen und Fallgruben auf dem spirituellen Weg. In E. Zundel & B.
Fogel, A. (2013) Selbstwahrnehmung und Embodiment in der Körperpsychotherapie. Stuttgart: Schattauer.
Fromm, E. (1977). Die Kunst des Liebens. Frankfurt am Main: Ullstein.
Grof, S. (1985). Geburt, Tod und Transzendenz: Neue Dimensionen in der Psychologie. München: Kösel.
Grof, S. (1987). Das Abenteuer der Selbstentdeckung. München. Kösel.
Grof, S., & Bennett, H. Z. (1993). Die Welt der Psyche: Neue Erkenntnisse aus Psychologie und Bewußtseinsforschung. München: Kösel.
Maslow, A. (1973). Psychologie des Seins. München: Kindler.
Maslow, A. (1994). Die umfassende Reichweite der menschlichen Natur. Integrative Therapie. (3), pp. 200–208.
Petzold, H. (1993). Integrative Therapie: Band 1-3. Paderborn: Junfermann.
Quekelberghe van, R. (2005). Transpersonale Psychologie und Psychotherapie: Grenzenlose Grenze des Bewusstseins. Frankfurt am Main: Klotz.
Reuter, W. (March 2007): Kein Sex ohne Liebe. Ursache und Wirkung. (59), pp. 17-19.
Rudolf, G. (2006). Strukturbezogene Psychotherapie. New York: Schattauer.
Thieme, Paul (1985): Upanischaden. Stuttgart: Reclam.
Walch, S. (1981). Subjekt, Realität und Realitätsbewältigung. München: Minerva.
Walch, S. (2009). Dimensionen der menschlichen Seele. 4.Aufl. Düsseldorf: Patmos.
Walch, S. (2013). Vom Ego zum Selbst. 3.Aufl. München: O.W.Barth.
Walch, S. (2016). Die ganze Fülle deines Lebens. Munderfing: Fischer u. Gann.
Artikel zum Thema
Dr. Sylvester Walch – Wege zur Ganzheit. Spiritualität und Psychotherapie im Dialog Teil 1
Prof. Dr. Niko Kohls – Die gesellschaftliche Akzeptanz von Achtsamkeit und Spiritualität, Teil 1
Dr. Sylvester Walch – Transpersonales Selbst
Benedict Newton – Das Ego ist nicht der Feind
Vivian Dittmar – Gefühl, inneres Navi, Intuition
Ronald Engert / Saskia Baumgart – Was ist Spiritualität? Die Essenz des Lebens
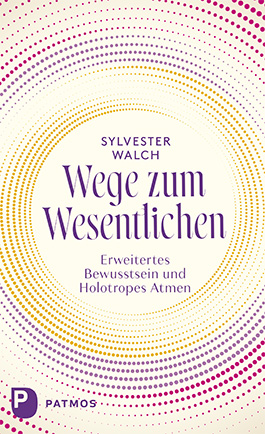
Dr. Sylvester Walch – Wege zum Wesentlichen
Erweitertes Bewusstsein und
Holotropes Atmen, Patmos,
Ostfildern 2024, geb., 246 S., € 26,00



